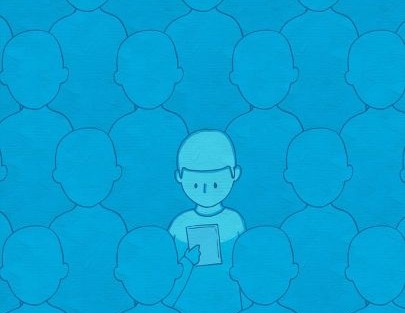Viele Menschen wünschen sich einfache Antworten: Wie viel Vitamin oder Mineralstoff brauche ich am Tag? Genau dafür gibt es die Referenzwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Sie wirken verlässlich, eine Zahl, schwarz auf weiß. Doch wer genauer hinschaut, erkennt: Diese Werte sind alles andere als ein Garant für optimale Versorgung.
Woher kommen die Werte?
Die DGE berechnet ihre Referenzwerte auf Basis von Studien. Das klingt nach Wissenschaft – doch auch hier gibt es Schwächen:
- Einseitige Probanden: Viele Daten stammen aus älteren Studien mit gesunden Männern. Unterschiede zwischen Frauen, Kindern, Älteren oder chronisch Kranken werden kaum berücksichtigt.
- Fragwürdige Kriterien: Ob man einen Wert vom Schutz ungesättigter Fettsäuren (Vitamin E) oder nur vom Ausgleich täglicher Verluste ableitet, ist eine Entscheidung, keine objektive Wahrheit.
- Interpretation statt Fakt: Studien liefern Daten. Wie daraus ein Referenzwert wird, hängt von der Auslegung ab. Wird ein Sicherheitszuschlag eingerechnet oder gestrichen, wie beim Jod? Genau das zeigt: Es ist immer eine Frage der Setzung.
Kurz gesagt: Die Berechnungen mögen methodisch korrekt sein, aber sie sind nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung.
Ein aktuelles Beispiel: Jod und Vitamin E
Gerade erst hat die DGE die Referenzwerte für Jod und Vitamin E angepasst. Offiziell heißt es: Man wolle die Empfehlungen enger an die aktuelle Datenlage anlehnen. Doch bei genauerem Hinsehen zeigen sich Probleme.
- Jod: Der bisherige Sicherheitszuschlag wurde gestrichen. Für Erwachsene gilt nun ein niedrigerer Wert, obwohl die Jodversorgung in Deutschland nach wie vor lückenhaft ist.
- Vitamin E: Statt wie bisher am Schutz der ungesättigten Fettsäuren auszurichten, orientiert sich die Ableitung jetzt am Ausgleich täglicher Verluste. Dadurch sinken die empfohlenen Mengen, spielt Prävention keine Rolle mehr?
Für gesunde Durchschnittsmenschen mag das vertretbar sein. Für Menschen mit Stress, Vorerkrankungen oder erhöhtem oxidativem Bedarf ist es fragwürdig.
Abgeleitet unter Idealbedingungen
Selbst wenn die Modelle stimmen, haben sie einen Haken: Sie setzen Bedingungen voraus, die mit unserem Alltag oft wenig gemeinsam haben.
- Ernährungsgewohnheiten: Kaum jemand isst so ausgewogen wie in Lehrbüchern. Viel Zucker, verarbeitete Lebensmittel, zu wenig Obst und Gemüse. All das spiegelt sich in den Referenzwerten nicht wider.
- Lebensmittelqualität: In Tabellen liest man: „Ein Apfel enthält 10 mg Vitamin C.“ In der Realität hängt es davon ab, wo er gewachsen ist, wie lange er gelagert wurde, ob er gespritzt wurde und wie er zubereitet wird. Zwischen Theorie und Praxis können Welten liegen.
- Industrie und Marketing: Verpackungen locken mit „reich an Vitamin XY“, gemeint ist der theoretische Gehalt, nicht das, was nach Transport, Lagerung und Zubereitung tatsächlich noch im Körper ankommt.
Warum stehen auf Verpackungen andere Zahlen?
Viele Menschen wundern sich: „Auf meinem Saft steht 60 % des Tagesbedarfs, aber die DGE sagt doch etwas anderes?“ Das liegt daran, dass es verschiedene Systeme gibt.
- D-A-CH-Referenzwerte: Offizielle Empfehlungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
- NRV nach LMIV (Lebensmittelinformationsverordnung): Diese Zahlen gelten nur für die Kennzeichnung auf Lebensmitteln. Sie sind europaweit vereinheitlicht und dienen nicht als persönliche Empfehlung.
- UL (Tolerable Upper Intake Level): Das ist der obere sichere Rahmen. Hier zeigt sich oft, wie konservativ die Empfehlungen sind. Beispiel Vitamin D: Empfohlen werden 800 I.E., sicher sind laut EFSA bis 4000 I.E.
Schon dieser Überblick zeigt: Es gibt nicht den einen Wert. Es gibt Modelle, Kennzahlen und Sicherheiten: aber keine Zahl, die für jede Lebenssituation passt.
Werte für den Durchschnitt – aber auch für Sie?
Die offiziellen Empfehlungen richten sich an eine fiktive „gesunde Durchschnittsperson“. Sie berücksichtigen nicht:
- Stress, Medikamente und Umweltbelastungen, die den Bedarf steigern können,
- individuelle Unterschiede in Aufnahme und Verwertung,
- besondere Lebenssituationen wie Schwangerschaft, Stillzeit, Wechseljahre oder chronische Erkrankungen.
Mit anderen Worten: Die Werte mögen auf dem Papier stimmig sein. Aber sie sagen nichts darüber aus, ob Sie persönlich optimal versorgt sind.
Was bedeutet das für Sie?
- Sehen Sie die DGE-Werte als grobe Orientierung, nicht als Gesundheitsgarantie.
- Verlassen Sie sich nicht allein auf Tabellen, sondern hören Sie auf Ihren Körper: Müdigkeit, Infektanfälligkeit, Hormonstörungen oder Hautprobleme können Hinweise auf Defizite sein.
- Eine gezielte Überprüfung im Labor oder durch Anamnese zeigt, was Sie wirklich brauchen.
- So lässt sich eine bedarfsgerechte Zufuhr planen,weder zu wenig noch „ins Blaue hinein“.
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Nährstoffversorgung ausreicht: Sprechen Sie mich gerne an. Gemeinsam finden wir heraus, was Ihr Körper wirklich braucht – statt sich allein auf allgemeine Durchschnittswerte zu verlassen.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und überlegen, ob ich Sie auf Ihrem Weg unterstützen könnte, lade ich Sie zu einem kostenfreien 15-minütigen Telefongespräch ein. Dabei geht es nicht um eine Beratung, sondern darum, herauszufinden, ob wir zueinander passen und ob ich die richtige Ansprechpartnerin für Ihr Anliegen bin.